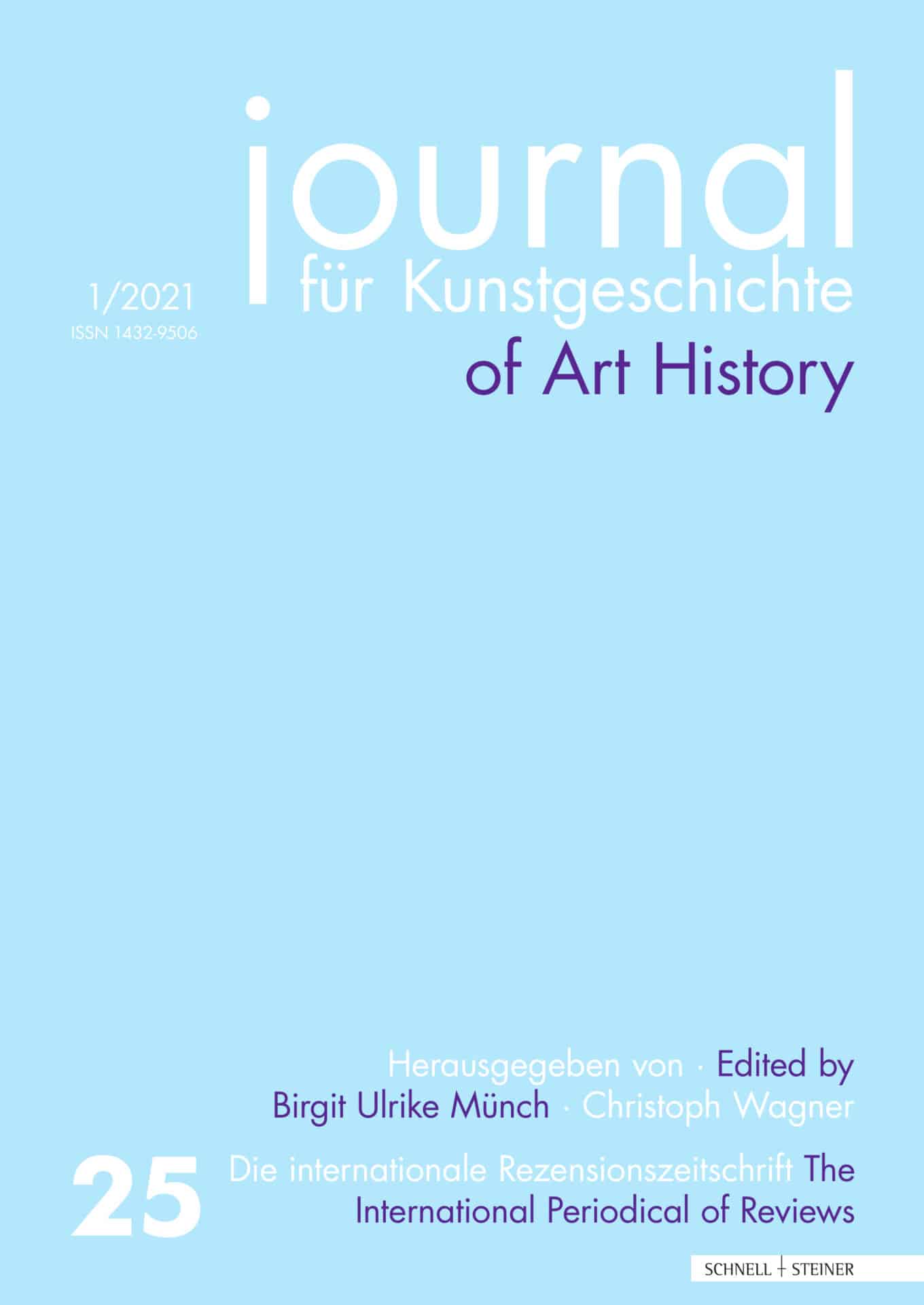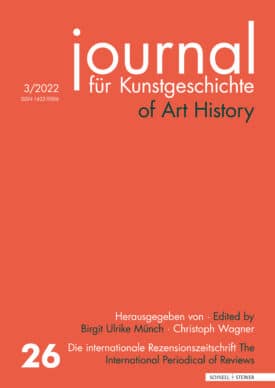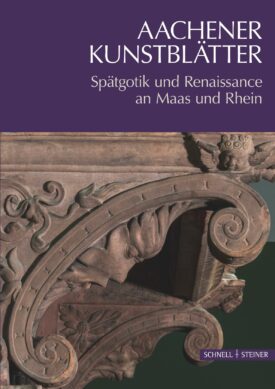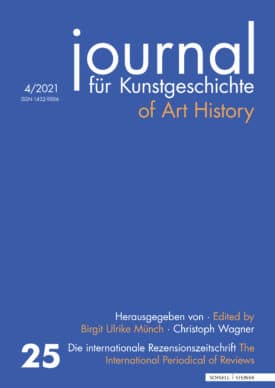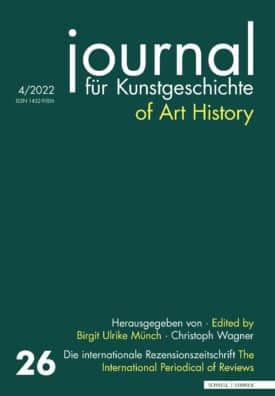Vorwort der Herausgeber Abbild einer veränderten Realität statt Sprachverwirrung Die Pandemie hat uns und damit auch die Tagespresse verständlicherweise noch immer völlig in ihrem Bann. Dennoch gab es im Januar ein nicht mit Covid-19 in Verbindung stehendes Thema, das zu einer breiten, sehr kontroversen Diskussion geführt hat: die Nachricht, der Duden, wohlgemerkt zunächst nur beschränkt auf die Online-Version, führe eine Umschreibung von 12.000 Artikeln über Personen- und Berufsbezeichnungen durch. In den entsprechenden Begriffen (Bäcker, Mieter) wird es auch die Bäckerin oder Mieterin geben, das generische Maskulinum solle hierdurch, so die Presse alarmistisch, ‚abgeschafft werden‘. Ein neues Bewusstsein für eine gendersensible Sprache, so Kathrin Kunkel-Razum, Leiterin der Duden-Wörterbuchredaktion, in einem Interview vom 29. Januar 2021 in der Zeit Online, sei wichtig, jedoch: „die generische Verwendung des Maskulinums solle nicht bestritten werden“1, und eine einseitige Positionierung sei abzulehnen, vielmehr konkretisiere die Duden-Redaktion die Einträge im Online-Wörterbuch für männliche und weibliche Personenbezeichnungen. Dem Arzt wird nun auch die Ärztin gleichberechtigt zur Seite gestellt, dem Künstler die Künstlerin, dem Goldschmied die Goldschmiedin. „Wir bilden eine veränderte sprachliche Realität ab“, so Kunkel-Razum.2 Peter Eisenberg, bis 2005 Professor für Deutsche Sprache der Gegenwart an der Universität Potsdam und 2019 für seine „großartigen Leistungen in der Erforschung der deutschen Grammatik“3 mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ausgezeichnet, sieht dies anders und fand in seinem FAZ-Artikel vom 8. Januar 2021 deutliche Worte.4 Er spricht vom ‚Einknicken‘ des Dudens vor den Anhängern des sprachlichen Genderns und von einer Spaltung der Sprachwissenschaft, deren größter Interessensverband, die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) gar einen Blog gestartet habe, in dem sich die Mitglieder zu einer Satzungsänderung im Sinne einer geschlechterinkludierenden Schreibung äußern sollten. Vor allem der Genderstern wird kritisiert, benutzt um transsexuelle, transgender oder intersexuelle Personen sichtbar zu machen und vor Diskriminierung zu schützen. Hiermit werde, so Eisenberg, jedoch mitnichten eine „intendierte Bedeutung oder sprachliche Funktion genannt, sondern eine Einstellung des Benutzers“, die Nutzung des Gendersterns komme einer „Unterwerfungsgeste“ gleich. Der Artikel war erwartungsgemäß Wasser auf die Mühlen all jener, die in ihren Leserbriefen von einer Modeideologie sprechen, der man sich aus moralischem oder politischem Druck beuge. Bemerkenswert ist, wie immer wieder einerseits von dem Eigenen, Heteronormativen und andererseits von den abjekten Anderen die Rede ist, von einer Abgrenzung, die sich nicht nur auf Frauen, sondern gar auf sämtliche möglichen Geschlechter bezieht. „Der Stern macht nichts sichtbar als den Stern“ schreibt Eisenberg5 – davon abgesehen, dass dieser Satz mit Blick auf die spezifische deutsche Geschichte zumindest irritierend wirkt, dürfte er für eine Person, die sich als trans, queer oder inter beschreibt, wie jedes Zeichen sehr wohl eine Bedeutung für die eigene Identität haben. Wer auch immer bei diesem Thema rein sprachhistorisch argumentiert, verkennt die soziale und politische Bedeutung von Sprache. Auch sollte man gerade in Fachdisziplinen, die dezidiert in historischen Kategorien denken, nicht die Dynamiken und Transformationsprozesse, die die Sprachen in der Vergangenheit erst zu dem werden ließen, was sie heute sind, vergessen: Ein gängiger ästhetischer Schlüsselbegriff wie ‚sprezzatura‘ (Leichtigkeit/Mühelosigkeit/Lässigkeit) wurde durch Baldassare Castiglione als Wortneuschöpfung in den humanistischen Diskursen der italienischen Renaissance etabliert. Auch auf philosophischer Ebene hat man seit langem und vielfältig aufgezeigt, wie sehr die Prozesse sprachlicher Bedeutungsbildung einer historisch wandelbaren, hermeneutischen Beteiligung der Verstehenden unterliegen: Es gibt auch in der historischen Entwicklung von Sprache keinen archimedischen Punkt außerhalb der Geschichte! Die in der Sprachwissenschaft derzeit hitzig geführte – und sicherlich noch eine Zeit lang zu führende – Debatte beeinflusst auch unsere Arbeit am Journal für Kunstgeschichte: Per definitionem sieht sich ein Rezensionsjournal, das obendrein mit einer international geweiteten Perspektive auf kunstwissenschaftliche Neuerscheinungen blickt, nicht nur mit den unterschiedlichsten kunsthistorischen Themengebieten, mit ihren auch dort zu beobachtenden eigenen terminologischen und sprachlichen Wandlungsprozessen konfrontiert, sondern auch mit einer Vielzahl unterschiedlichster auktorialer Sprachstile, Begrifflichkeiten und auch wechselnder Wissenschaftsjargons. Nirgendwo werden die aktuellen Diskussionen um gendergerechte Sprache, aber auch ästhetische und moralische Normierungen hartnäckiger und nachhaltiger ausgetragen als im Feld der Gegenwartskunst, in dem Künstlerinnen wie Cindy Sherman, Rosemarie Trockel, Pipilotti Rist, Jenny Holzer, Judy Chicago, Valie Export, Carolee Schneemann, um nur einige Namen zu nennen, mit Recht gegen überkommene Limitierungen und verkrustete Grenzziehungen zu Genderfragen künstlerisch zu Felde ziehen. Die Kunstwissenschaft hat auch diese veränderte sprachliche und künstlerische Realität abzubilden. Wie weit diese Fragen und Diskurse zu Geschlecht, Geschlechtsidentität und Gender auch in die ältere Kunstgeschichte zurückreichen, zeigen im vorliegenden Heft die Rezensionen von Elisabeth Oy-Marra zur Publikation über Christiane von Lothingen mit dem Untertitel Geschlechterdiskurs und Kulturtransfer zwischen Florenz, Frankreich und Lothringen (1589–1636) oder von Barbara Muhr zur Katalogpublikation Max Beckmann. weiblich–männlich, in der mit Blick auf Beckmanns Verhältnis zu den Frauen Geschlechterdiskurse des frühen 20. Jahrhunderts thematisiert werden. Selbstverständlich werden im Journal für Kunstgeschichte alle Publikationen nach guter alter quellenkritischer Tradition unverändert und im Wortlaut so zitiert und vorgestellt, wie dies im publizierten Originaltext zu finden ist. Selbstredend haben auch unsere Rezensentinnen und Rezensenten ihre eigene Sicht auf diese Frage einer gendergerechten Darstellung und eine selbstbestimmte Sprache, in der sie ihre Publikationen vorstellen. Als HerausgeberIn sind wir weit davon entfernt, in die Freiheit der eigenen Sprache, die unaufhebbar mit der Freiheit der Wissenschaft und Kunst verbunden ist, einzugreifen, etwa auf dem Wege von Trainingseinheiten in ‚Equality and Diversity‘, wie sie jüngst von der Universität Cambridge für den geisteswissenschaftlichen Lehrkörper als Pflichtveranstaltung angeboten werden. So finden Sie auch in diesem aktuellen Heft sehr unterschiedliche Umgangsweisen in der sprachlich- stilistischen Gestaltung. Friedrich J. Becher, Autor der Rezension von Carolin Overhoff Ferreiras Buch Decolonial Introduction to the Theory, History and Criticism of the Arts wählt beispielsweise geschlechterneutrale und diversitätssensible Formulierungen wie „die Lesenden“. Die Formulierung „Leserinnen und Leser“ findet sich alternierend in weiteren Beiträgen dieses Hefts. Der Beitrag von Lena Hensel zu den Surrealisten ist in diesem Zusammenhang gendersensibler Sprache insofern von Interesse, als dass sich die Ausstellung, deren Katalog besprochen wird, gerade mit den Frauen des Surrealismus auseinandersetzt (herausgegeben von Ingrid Pfeiffer: Fantastische Frauen. Surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo). Wie, so ist auszuloten, stellt sich das Fach Kunstgeschichte in Zukunft gerade bezüglich Künstler*innengruppenbezeichnungen wie den ‚Surrealisten‘, um hier nur ein Beispiel unter vielen zu nennen? Wie können wir in unseren Rezensionen Personen non-binären Geschlechts inkludieren? Als vorläufige Antwort – mittendrin im Diskurs – könnte eine verbalisierte Momentaufnahme lauten: Das Journal für Kunstgeschichte möchte dem Gedanken der Diversität von Geschlechtsidentitäten und der Vielfältigkeit ihrer Darstellungsformen insofern Rechnung tragen, als dass es sich selbst der Offenheit in der Frage nach Darstellung von Geschlechtsidentitäten verschreibt, und dabei zunächst keine starre, verpflichtende Richtlinie aufstellt, sondern die Rezensentinnen und Rezensenten dabei unterstützt, für sich im Einzelnen eine sinnvolle Antwort auf diese Frage zu finden und in ihren jeweiligen Text zu integrieren. So wurde es in diesem Heft bereits praktiziert. Währenddessen wird die Debatte um gendergerechte Sprache seitens Herausgeberschaft und Redaktion weiterhin aufmerksam, interessiert und selbstkritisch verfolgt, und zu gegebenem Zeitpunkt wird sicherlich neu zu entscheiden sein, welche Antwort das Journal in Bezug auf gendergerechte Sprache geben kann, um veränderte sprachliche, aber auch wissenschaftliche und künstlerische Realitäten angemessen und gendersensibel abzubilden. Nicht übersehen werden darf, dass sich auch zahlreiche andere Fragen nichtdiskriminierender Sprache stellen und in Zukunft noch stellen werden, wie nicht nur der bereits genannte Text von Friedrich J. Becher deutlich macht, beispielsweise in der Integration von Bezeichnungen wie People/Person of Color (PoC), Indigenous People und anderen. So werden wir uns auch den Diskursen und Paradigmenwechseln in den Diskussionen über rassistisch und kolonialistisch kontaminierte wissenschaftliche Diskurse und Kategorienbildungen in Zukunft expliziter stellen. Nicht zuletzt freuen wir uns, dass wir mit den Beiträgen im Journal für Kunstgeschichte – gerade auch in Zeiten einer pandemiebedingt erschwerten Zugänglichkeit zu Literatur in den Bibliotheken – weiterhin den Stoff für solche Reflexionen zugänglich machen können. Dafür sei allen Autor*innen für ihre Beiträge und unseren Mitarbeiterinnen Celina Berchtold, Anna Baumer und Hannah Semsarha für ihre redaktionelle Unterstützung herzlich gedankt.
Journal für Kunstgeschichte – Jahrgang 2021 Heft 1
Heft 1 von 2021
Vorwort der Herausgeber Abbild einer veränderten Realität statt Sprachverwirrung Die Pandemie hat uns und damit auch die Tagespresse verständlicherweise noch immer völlig in ihrem Bann. Dennoch gab es im Januar ein nicht mit Covid-19 in Verbindung stehendes Thema, das zu einer breiten, sehr kontroversen Diskussion geführt hat: die Nachricht, der Duden, wohlgemerkt zunächst nur beschränkt auf die Online-Version, führe eine Umschreibung von 12.000 Artikeln über Personen- und Berufsbezeichnungen durch. In den entsprechenden Begriffen (Bäcker, Mieter) wird es auch die Bäckerin oder Mieterin geben, das generische Maskulinum solle hierdurch, so die Presse alarmistisch, ‚abgeschafft werden‘. Ein neues Bewusstsein für eine gendersensible Sprache, so Kathrin Kunkel-Razum, Leiterin der Duden-Wörterbuchredaktion, in einem Interview vom 29. Januar 2021 in der Zeit Online, sei wichtig, jedoch: „die generische Verwendung des Maskulinums solle nicht bestritten werden“1, und eine einseitige Positionierung sei abzulehnen, vielmehr konkretisiere die Duden-Redaktion die Einträge im Online-Wörterbuch für männliche und weibliche Personenbezeichnungen. Dem [...]